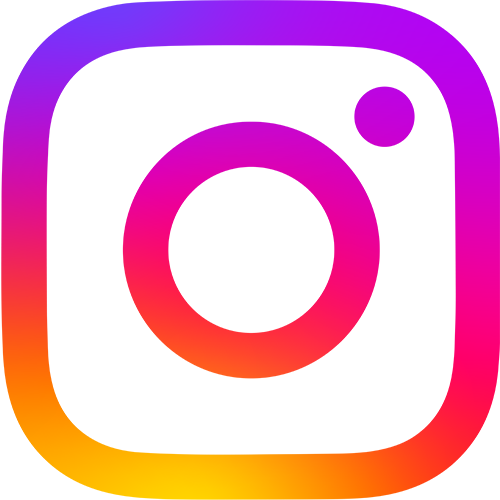Zeit statt Zeug
André Krause über den Wert gemeinsam erlebter Zeit
Der IC nach Warnemünde ist kaum belegt. Ich genieße das stille Schaukeln. In Magdeburg ändert sich das schlagartig: Vier Kinder poltern lachend in den Wagen. Eine ältere Frau kommt dazu, sortiert die kleine Reisegruppe am Tisch. Wir Mitreisenden werden unfreiwillig Ohrenzeugen, wohin die Reise geht: Urlaub an der Ostsee, exklusiv mit der Oma. Ich bin genervt. Hätte gerne wie manch anderer im Wagen meine Kopfhörer lauter gestellt. Aber es gibt kein Entrinnen vor dem fröhlichen Treiben. Spiele werden ausgepackt und bei Stadt-Land-Fluss werden sogar Mitreisende zu Mitspielern. Handyzocken wird auf später verschoben. Dafür schmieden sie Pläne für die gemeinsame Urlaubszeit. Je länger je mehr bin ich fasziniert von der munteren Gesellschaft. Geduldig und liebevoll geht die Oma auf alle Bedürfnisse ein. Sie hat ein Händchen für ihre Enkel.
Meine Gedanken wandern zurück in meine Kindheit. Viele Ferien habe ich bei meinen Großeltern verbracht. Ihnen verdanke ich viele Erinnerungen, die mein Leben geprägt haben. Gemeinsame Zeit ist wertvoller, als jedes Geschenk. Sie verbindet, nährt die Seele und schafft Bleibendes in uns. Wir sollten einander mehr Zeit, statt Zeug schenken. Der Sommer lädt dazu ein. Wie die Oma in meinem Waggon. In Wittenberge steige ich aus und bedanke mich bei ihr herzlich für ihr Vorbild.
André Krause, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Leipzig (Baptisten)
Kontakt: kolumne@kirche-leipzig.de
Foto: Birgit Arndt (fundus.media)
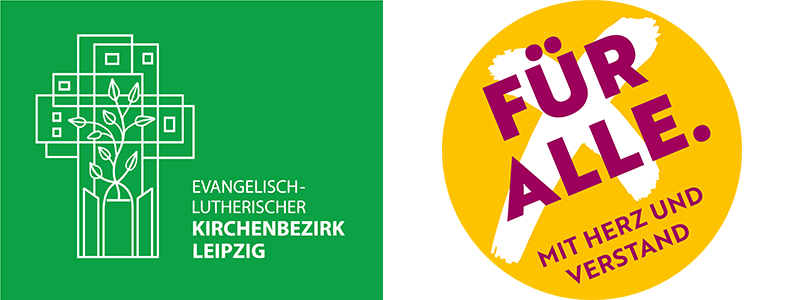

 Fundus-media ©Hans-Georg Vorndran_fundus-medien.de
Fundus-media ©Hans-Georg Vorndran_fundus-medien.de



 Europaparlament_Strassburg-©Peter Bernecker_fundus-medien.de
Europaparlament_Strassburg-©Peter Bernecker_fundus-medien.de © Anna-Luisa Hortien / fundus-medien.de
© Anna-Luisa Hortien / fundus-medien.de